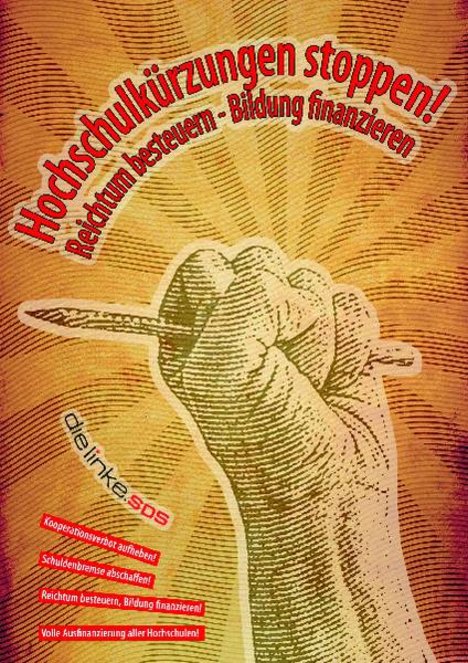Die studentische Protestbewegung in der politischen Ohnmacht? – Perspektiven und Herausforderungen einer bundesweiten studentischen Protestbewegung von links.
Hannover Anfang Mai 2015: Ca. 40 Personen sind einem Aufruf an die Universität zu einem bundesweiten Vernetzungstreffen des neuen noch jungen Protestbündnisses „Lernfabriken meutern“ gefolgt. Diskutiert werden sollen die inhaltliche und öffentliche Positionierung des Bündnisses und insbesondere die Frage danach, wie so agiert werden kann, dass dieses Label nicht ein „Bildungsstreik 2.0“ wird. Wie können breite Bündnisse organisiert werden? Welche Aktionen können gestartet werden? Wie schafft es das Bündnis basisorientiert und bottum-up zu arbeiten und so vor allem die Lebensrealitäten der in „Lernfabriken befindlichen Menschen“ aufzugreifen und in seinem Protest zu artikulieren?
Vor allem die letzte Frage ist eine unglaublich wichtige, denn die Versuche bildungsstreikähnliche Proteste zu organisieren sind zugegebenermaßen mit „Bildung braucht…!“ (2013) und dem #Bildungsstreik14 (2014) im Sande verlaufen und waren de facto nicht mehr als eine kurze inhaltlich teils sehr verengte und auch entsprechend sehr selektiv wahrgenommene Erscheinung. Längerfristig angelegt und verknüpft mit einer grundlegenden linken emanzipatorischen Kritik am bestehenden Bildungssystem war dies alles noch nicht wirklich. Umso wichtiger ist es nun sich der Rahmenbedingungen und Herausforderungen bewusst zu werden, denen sich eine studentisch begründete Protestbewegung ausgesetzt sieht und die beachtet werden müssen, wenn sie von links mehr prekär Beschäftigte und sozial benachteiligte Menschen erreichen will, die innerhalb UND außerhalb der Hochschulen angesprochen werden müssen, um erfolgreich „#meutern“ zu können, wie es beim neuen Bündnis heißt.
Der nachfolgende Text soll eine Diskussionsgrundlage für diese Problematik darstellen, die weder den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und sich auch nicht als universale Problembeschreibung versteht. Er entstand ausgehend von den Ergebnissen einer Diskursanalyse der medialen Darstellung und politischen Wahrnehmung vergangener Bildungsproteste im Rahmen meiner Masterarbeit.
------
Das Jahr 2014 sollte, so die Intention der Studierendenvertreter*innen Anfang des Jahres, im Zeichen eines neuen bundesweiten Protestes unter dem Label #bildungsstreik 14 stehen.
Doch im Rückblick zeigt sich, dass die Proteste nur regional begrenzt wahrgenommen wurden und eine kontinuierliche bundesweite Koordinierung schwer fiel. Damit stellt sich erneut die Frage: Befindet sich die studentische Protestbewegung in einem Zustand politischer Ohnmacht? Und was bedeutet dieser Zustand der „studentischen Protestbewegung“ für diese und für den SDS, als linker Studierendenverband?
Ein bestimmtes Protestpotenzial ist weiterhin vorhanden, jedoch ist es gekennzeichnet durch einen begrenzten Aktionsradius. Prägnante Beispiele dafür wären die Veranstaltungen Ende 2013 in Erfurt und Jena mit insgesamt 10.000 Teilnehmer*innen oder die bundesweiten Demonstrationen am 25.06.2014, bei denen in Leipzig und Wiesbaden insgesamt ca. 15.000 Demonstrant*innen zusammenkamen. Zudem liefen und laufen Aktionen in den einzelnen Bundesländern, wie derzeit in Kiel unter dem Motto „Uni ohne Geld“, die in unterschiedlichster Art und Weise auf die Unterfinanzierung und in der Folge auch auf die Ökonomisierung der Wissenschaft und Hochschulen aufmerksam machen. Aber es zeigt sich deutlich, dass es seit 2009 nicht mehr möglich war eine tatsächlich bundesweit wahrgenommene Bündnisstruktur zu etablieren, die über kurzzeitige Aktivierungsintervalle hinweg aktiv werden konnte.
Studierendensurvey: Studierende eine hedonistische und egoistische Klasse?
Die Debatte über die politischen Einstellungen der Studierenden erhielt im Oktober 2014 einen kurzen Aufwind. Das 12. Studierendensurvey[1], herausgegeben im Auftrag der Bundesregierung, zum Wertewandel und der politischen Einstellung Studierender, zeichnete ein Bild einer vermeintlich unpolitischen und weitgehend entsubjektivierten Studierendenschaft, wonach nur noch jede*r für sich selbst studiert und die stark „ichbezogen“ ist . Medial fokussiert auf die Studierenden muss zunächst festgehalten werden, dass sich diese Gruppe in der tendenziellen Entwicklung nicht von anderen Gesellschaftsgruppen unterscheidet. Die Landnahme des neoliberalen Systems bis in das Private führt nicht zuletzt zu einer zunehmenden Vereinzelung und Entsolidarisierung in der gesellschaftlichen Breite. In der medialen und auch linken Auseinandersetzung damit wurde spezifisch auf die Hochschullandschaft daher zu Recht darauf verwiesen, dass diese Ergebnisse unter dem Gesichtspunkt des zunehmend verschulten Studiums und der Restriktionen des Bologna-Systems betrachtet werden müssen. Dieses erlaubt es Studierenden kaum noch studentische Vertretungsarbeit wahrzunehmen oder auch eine kritische Reflexion der Lerninhalte und Hochschulstruktur Teil der Alltagspraxis werden zu lassen. Die „Entpolitisierung“ der Studierendenschaft - genauer betrachtet der einzelnen Studierenden - fügt sich dabei ein in eine gesamtgesellschaftliche Tendenz: die oft irreführenderweise als „Politikverdrossenheit“ bezeichnete Institutionenverdrossenheit und damit in diesem Fall die Tendenz der Entfremdung von der Hochschule als Ort des Lebens und Lernens. Nicht nur, dass das Desinteresse an der studentischen und akademischen Selbstverwaltung[2] weiter sinkt, auch das Interesse an politischen Studierendengruppen nimmt laut des Surveys weiter ab. Ca. 1/3 der Befragten zeigte sich daran interessiert und lediglich 4 % gaben an auch tatsächlich engagiert zu sein.
Entsubjektivierung der Masse – Eine Problemanalyse studentischen Wertewandels
Die Frage nach den Ursachen dafür lässt sich mit dem Rückgriff auf die kritischen Analysen der politischen Sozialisation von Studierenden von Sabine Kiel[3] und Johann August Schülein[4] anreißen. Kiel benennt als entscheidende Voraussetzung für eine Bereitschaft der studentischen Partizipation an politischen Prozessen die Informiertheit über und die Komplexität von Sachverhalten. Kiel bezieht sich in diesem Kontext ihrer Untersuchung auf ein Erklärungsmodell von Schülein. Demnach ist die Entwicklung der Hochschule zum Bildungsdienstleister, der Massenhochschule als „Großbetrieb“ und die zunehmende Abhängigkeit der Hochschulen von gesellschaftlichen wie finanziellen Ressourcen, im Kontext der politischen Steuerung durch die politischen Entscheidungsträger*innen bei der Mittelzuweisung, eine Ursache für die „Entsubjektivierung der Masse“[5]. Hinzu kommt die Marginalisierung von Lehre durch ein sich verschlechterndes Betreuungsverhältnis. Für die Studierenden wird der Hochschulbesuch gezwungenermaßen zum reinen biografischen Kalkül. Damit wird die Rolle der Hochschule auf die als Ausbilderin für die Privatwirtschaft reduziert. Die Identifikation mit der Hochschule als Teil des Lebensumfeldes sowie als Mitglied der Statusgruppe der Studierenden geht verloren, wodurch sich letztlich das Protestpotenzial verschlechtert. Dieser Rückzug aus dem „alltäglichen Aktionsfeld“ der Hochschule führt zu einer Entfremdung und Skepsis gegenüber politischen Entscheidungsgremien und Selbstverwaltungsstrukturen, da sich deren Entscheidungen nicht auf den primären Studienverlauf auszuwirken scheinen bzw. die Auswirkungen dieser nicht transparent nachvollziehbar sind. Nun entstanden die studentische Proteste der letzten Jahre in der Regel aus diesen hier genannten studentischen Selbstverwaltungen heraus, zumindest dort, wo diese durch die Einbindung linker Studierendengruppen progressiv genug waren und sind. Durch die zunehmende Entfremdung zwischen Studierenden und der Hochschule als Ort des Lebens, Lernens und kritischen Denkens entsteht darüber hinaus gerade in Zeiten hochschulpolitischer Krisenzeiten schnell eine als Stellvertreter*innendiskussion wahrgenommene Protestkultur, die zum einem eine große Masse von Studierenden verschreckt und zum anderen nicht darüber hinauskommt in kurzen Aktivierungsphasen Protest zu organisieren. Dies führt sukzessive zu Entsolidarisierungseffekten seitens der Studierendenschaft[6].
Die mangelnde Mobilisierungsfähigkeit der studentischen Proteste hat aber auch noch weitere Ursachen, die wir in der theoretischen Betrachtung für die politische Praxis beachten müssen. Die Kommunikation und Artikulation der Statusgruppe nach außen stellte nicht selten ein grundlegendes Problem dar. Trotz der steigenden Zahlen an Studierenden in der Bundesrepublik in den vergangenen Jahren, herrscht in der gesellschaftlichen Betrachtung immer noch das Bild einer Bildungselite vor, was die Artikulation der Problemlagen und die Problemadressierung durch studentische Protest erschwert. Lepenies[7] hat die Kommunikation der Studierenden und die Artikulation der Problemlage im Kontext der 68-er Proteste betrachtet und kommt mit Rückgriff auf die Thesen von Herbert Marcuse zu folgenden Schlussfolgerungen, die in der Analyse der medialen-öffentlichen Kommunikation der Studierendenproteste immer noch Beachtung finden sollten:
Die studentischen Medien und Protestaktionen dienten in erster Linie dazu, die internen Probleme der Hochschule öffentlichkeitswirksam zu diskutieren und daraus gesellschaftliche Folgen ableiten zu können. Die Übertragung der inneruniversitären Problemlagen überflutete die Öffentlichkeit mit einer informellen Komplexität, die von der Lebensrealität der Masse der bundesdeutschen Öffentlichkeit weit entfernt war. In der Folge hat es die studentische Opposition durch eine allgemeine Sprache und das Aufgreifen alltäglicher Problemlagen – sondern durch eine rein akademisierte überladene Thematisierungsstruktur - nicht geschafft Solidarisierungseffekte für die Proteste zu erreichen. Die weitestgehend isolierte Bewegung war zunehmend auf eine öffentlichkeitswirksame Personalisierung der Protestbewegung sowie eine Radikalisierung der Forderungen und Protestformen angewiesen, um dem schwindenden gesellschaftlichen wie medialen Interesse entgegenzuwirken, was letztlich in der studentischen Gruppe selbst zu Entsolidarisierungseffekten geführt hat und die Protestbewegung von innen heraus schwächte. Diese Schwächung diente letztlich auch hochschulintern dazu, beispielsweise seitens der Hochschulleitungen, diese Protestbewegungen und -aktionen diskreditieren zu können. Umso wichtiger wird es daher für studentische Proteste transparent und nachvollziehbar Probleme zu definieren, Ursachen zu benennen und Probleme an Akteur*innen zu adressieren. Sonst „vernachlässigen [die Studierenden] ein gemeinsames Handeln, da sie sich nur noch um ihre eigenen individuellen Interessen und Probleme bemühen“[8]. Nun muss diese Analyse auch dahingehen kritisch betrachtet werden, das es keine Alternative sein kann, den Anspruch eines radikalen Wandels der Kultur und des Leitbildes der Hochschule zu Gunsten einer vermeintlich breiten Mobilisierung aufzugeben. Allerdings lassen sich diese Schlussfolgerung vor dem Hintergrund der zuvor erläuterten Entsubjektivierung der Studierenden von der Hochschule anwenden, wenn politische Alternativkonzepte von links im hochschulpolitischen Kontext entwickelt werden sollen und es darum geht die Lebensrealitäten der Studierenden und anderer Gruppen in den Protest einzubinden.
Was heißt das für die Praxis linker Studierendenpolitik?[9]
1) Gesamtgesellschaftliches Anliegen weiterer Proteste darf nicht abstrakt bleiben: Die Proteste der vergangenen Jahre sind nicht selten daran gescheitert, dass die Problemadressierung an „die politische Elite“ gerichtet wurde, ohne die Verantwortlichen für die Problemlagen konkret zu benennen. Hier müssen Forderungen und die Ansprache konkretisiert werden. Des Weiteren muss die zu Recht benannte und wichtige Verknüpfung mit den alltäglichen sozialen Kämpfen auf eine konkrete Bündnisarbeit abzielen und darf nicht weiter nur in Worte gegossen werden, um die Verknüpfung lediglich zu formulieren. Die Bündnisarbeit muss den Protesten voran gehen sowie diese begleiten und darf nicht als Selbstläufer der Proteste begriffen werden. Die Problemlagen wurden zudem bisher meist eng auf den universitär gefassten Bildungsbegriff beschränkt. Die Proteste verstanden sich zwar immer als „gesamtgesellschaftlich“, dies blieben sie aber auf einer zu abstrakten Ebene. Die aktuellen Streiks im Bereich der frühkindlichen Bildung bieten dagegen eine Möglichkeit ganz praktisch und einrichtungsübergreifend Protest zu organisieren und gemeinsame Schnittmengen zu finden, die im Rahmen eines Bildungsprotestes als Forderungen und Probleme artikuliert werden können. Ein Modell der erfolgreichen Bündnisarbeit stellt aber auch die regionale teils sehr gelungene Zusammenarbeit mit Initiativen und Gruppen des „Mittelbaus“ dar. Diese Solidarisierung mit prekär Beschäftigten muss aber über den akademischen Bereich hinaus wachsen. Dabei kommt den „Anti-Kürzungskämpfen“ eine besondere Rolle zu. Diese müssen miteinander ausgetragen werden, ohne dabei zu vergessen, das die politische Dimension für eine möglichst breite gesellschaftliche Gruppe auf die zentralen Themen und Alltagsprobleme heruntergebrochen werden muss, um nicht nur die akademische Problemlage nach außen zu tragen.
2) Diversität der Protestmobilisierung und -formen fördern: Bei der Forderung nach einer radikalen Protestkultur mit vielfältigen Aktionen muss eine linke Studierendenpolitik allerdings auch beachten, dass ein Aktionskonsens gefunden wird, der „individuelle Protestbereitschaften“ beachtet, um dem gemeinsamen Ziel näher zu kommen. Die Ergebnisse des Studierendensurvey bestätigen die Tendenz, dass zunächst die direkten und erfahrbaren Missstände ein Aktivierungspotenzial besitzen und das politische Interesse auf die Beseitigung hochschulinterner Missstände bei den Studierenden begrenzt bleibt. Die Möglichkeit zur Protestmobilisierung steigt so durch die Erfahrbarmachung der eigenen Situation an der Hochschule und die kritischen Reflexion der Ursachen. Unter diesen Umständen ist die Bereitschaft zu Demonstrationen höher. Dies legen auch die Zahlen des 12. Studierendensurveys nahe, wonach 83 % der Befragten angaben, für ihre Überzeugungen im Falle von Missständen an der Hochschule für eine Verbesserung der Situation zu streiten. Die Bereitschaft sinkt fast erwartbar mit der „Radikalität“ der Aktionen. Gerade daher muss der Raum für verschiedene Protestformen eröffnet werden, die gleichberechtigt nebeneinander, aber im Rahmen eines gemeinsamen Aktionskonsenses stattfinden[10].
3) Bologna mit der eigenen Praxis schlagen, Bologna umdefinieren: Um all dies zu schaffen, muss es aber gelingen die Komplexität der Problemfelder an den Hochschulen in praktische Politik und Aktionen zu übersetzen. Das bedeutet auch sich mit den Forderungen der Masse der Studierenden als linker Studierendenverband zu konfrontieren. Eine Chance ist es nun, dass Bologna wegen des offensichtlichen Misserfolgs als Konzeption dazu beigetragen hat eine allgemeine Kritik am System Teil einer breiteren öffentlichen Debatte werden zu lassen, wie die Berichterstattung zu „15 Jahre Bolognareform“ im vergangenen Jahr gezeigt hat. Dennoch blieb die Hochschule weiterhin auch bei einem Großteil der Studierenden leider nur eine „Dienstleistung“ und weitere Ausbildungsstufe. Daher muss zum einem die Sprache und der Diskurs über und von Bologna auf die eigenen linken Ansprüche übersetzt werden und den Studierenden anhand ihre alltäglichen „kleinen Probleme“ vor Ort erfahrbar gemacht werden, wie diese mit dem System zusammenhängen. Zudem dürfen wir nicht davor zurückschrecken das System Bologna konkret umzugestalten, statt nur dessen Abschaffung ohne eine reale Alternative anzubieten. Um es plastischer zu beschreiben heißt das, dass die Steuerungsmuster der Politik und der Hochschulen nutzbar gemacht werden müssen für die eigene politische Praxis. „Qualitätsmanagement“, derzeit mit dem Blick auf die zweckdienliche Anpassung von Studiengängen für und an den Arbeitsmarkt, bietet die Möglichkeit die damit verbundenen und teils sinnvollen Evaluationsprozesse an den Hochschulen für die eigenen Ziele anwendbar zu machen. Dabei muss von links definiert werden, was Qualität im Studium bedeutet. Das geht nur, wenn die studentische Selbstverwaltung als „Instrument“ verstanden wird, mit dem auf Steuerungsprozesse in der Hochschule Einfluss auf die Entwicklung und Struktur der Hochschule zu nehmen ist, trotz der Widrigkeiten einer undemokratischen Entscheidungskultur.
Protest und Selbstverwaltung Hand in Hand gegen die neoliberale Hegemonie
Die Betrachtung des Bildungsstreik 2014 greift dabei auch eine Debatte auf, die mit der Vorstellung des Konzeptes von Marx 21 bei der Herbstakademie 2014 erneut Eingang in die verbandsinterne Auseinandersetzung über die Ausrichtung linker Studierendenorganisationen gefunden hat. Das Konzeptpapier von Marx 21 über die Ausrichtung einer linken Studierendenorganisation stellt mit einer provokanten These den SDS vor die Entscheidung sich in eine konkrete Rolle zwischen Studierendenbewegung oder studentischer Selbstverwaltung von links einzufügen. Was hier überspitzt als Gegensatz formuliert und in der Debatte auch nicht selten als Gegensatz aufgegriffen wird, schließt sich aber in keiner Weise aus. Als gleichberechtigte Form der studentischen politischen Arbeit und Partizipation muss die Selbstverwaltung ebenso wie der Protest als Ort verstanden werden, in dem die neoliberale Hegemonie des Diskurses sukzessive verdrängt werden kann. Eine Idee zur Unterstützung des bundesweiten Protestes ist es daher ein linkes Leitbild von „Qualität im Studium“ und weiteren Elementen der Hochschule zu entwickeln. Das bedarf einer Übersetzung der Probleme der Hochschulen auf gesellschaftliche Kämpfe, einer Befähigung zum kritischen Blick auf die „unternehmerische Hochschule“ und einem Verständnis für die Heterogenität der Studierendenschaft in ihren Biografien und damit einhergehenden Bezügen und Sichtweisen zur Hochschule. Lösungen zur Überwindung der neoliberalen Politik dürfen nicht allein nur angeboten werden, sie müssen verständlich und nachvollziehbar gemacht werden.
[1] Bundesministerium für Bildung und Forschung (2014). Studiensituation und studentische Orientierung: 12. Studierendensurvey an Universitäten und Fachhochschulen, Berlin.
[2] Von den Befragten äußerten 56 % ein Desinteresse gegenüber studentischer und 68 % gegenüber akademischer Selbstverwaltung und Hochschulpolitik.
[3] Kiel, Sabine (1996). Studierende und Politik. Eine kritische Analyse zur politischen Situation, BdWi: Marburg.
[4] Schülein, Johann August (1989). Veränderung der Studentenrolle? In: Huber, Ludwig & Wukf, Manfred (Hg.) Studium nur noch Nebensache?, Dreisam-Verlag: Freiburg, S. 133-152.
[5] Vgl. ebd., S. 50.
[6] Vgl. Kiel, 1996.
[7] Lepenies, Wolf (1968). Student und Öffentlichkeit. Kommunikationsprobleme einer Minderheit, in: Baier, Horst (Hg.) Studenten in Opposition: Beiträge zur Soziologie der deutschen Hoch-schule, Bertelsmann Universitätsverlag: Bielefeld.
[8] Vgl. Schülein, 1989, S. 142.
[9] Bezugnehmend auf die 6 Thesen des Bundesvorstandes für einen bundesweiten Protest in der Critica Sonderausgabe zum #bildungsstreik14
[10] Und letztlich müssen wir beachten, dass wir als SDS die Diversität der Bildungseinrichtung im Hochschulbereich nicht außer Acht lassen. Aus der Tradition heraus scheint sich der Verband auf den Kampf für „demokratische, friedliche und kritische Universität“ zu konzentrieren. Duale Hochschulen, Fachhochschulen und andere Einrichtungen in diesem Bereich müssen wir dabei genauso als Aktionsfeld begreifen, um ein breites Protestbündnis zu organisieren.